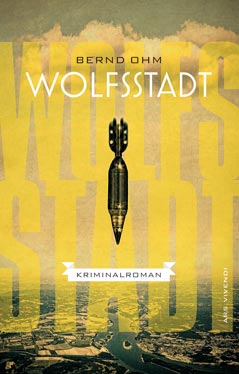Bernd Ohm
Lesung: »Wolfsstadt«
Grenzgänger
München, 1948. Die einstige »Hauptstadt der Bewegung « liegt in Schutt und Asche – doch für den Polizeikommissär Fritz Lehmann soll sie zum Startpunkt eines neuen Lebens werden. Eines, in dem er vergessen kann, dass er 1942 als Mitglied der OrPo (Ordnungspolizei) an einer Massenerschießung im ukrainischen Sarny beteiligt war, woraufhin er kollabierte, als »nicht ostfähig« heimgeschickt wurde – und einen Mantel des Schweigens über seine Vergangenheit legte. Eines, in dem er Jazz hören kann, in Bars gehen und sich an die Demokratie gewöhnen.
Dann passiert ein Mord, der die Stadt erschüttert: Die Gelegenheitsprostituierte Irina Stepaschkin wird brutal zugerichtet und mit abgetrennten Gliedmaßen in einem See bei München gefunden. Und plötzlich hat die Vergangenheit Lehmann wieder fest im Griff. Denn die Ermittlungen führen ihn zu jüdischen Überlebenden des Holocausts – just zu den Menschen also, an denen er sich damals schuldig gemacht hat. Obendrein bekommt er eine Vorladung der Alliierten, die nach deutschen Kriegsverbrechern fahnden. Ein Mörder sucht einen Mörder, der Jäger wird zum Gejagten. Für Lehmann ist klar: Nichts ist in diesen Zeiten wichtiger als das Vergessen – und nichts so gefährlich.
Bernd Ohm erzählt in seinem Debütroman eine packende Geschichte über Schuld in allen ihren Formen und schöpft dabei die literarischen Möglichkeiten des Bewusstseinsstroms voll aus. Das Resultat: ein akribisch recherchierter, komplex aufgebauter und absolut fesselnder Kriminalroman in der Tradition des Noir.
»Ich musste quasi in seinen Kopf hineinkriechen«
Ein Interview mit Bernd Ohm (7. April 2015)
Wolfsstadt zieht einen richtiggehend hinein in die düstere Münchner Nachkriegszeit – und das liegt vor allem an Ihrer besonderen Erzählhaltung. Wie kamen Sie dazu, die Geschichte in der Technik des Bewusstseinsstrom zu erzählen?
Zum einen hat das mit der Hauptfigur zu tun. Fritz Lehmann ist ja eigentlich einer dieser typischen Deutschen, die aus dem Krieg heimkommen und so tun, als ginge sie das alles nichts mehr an, als ob sie, um ein Wort von Carl Amery zu gebrauchen, auf einem »anderen Kontinent« gewesen wären, wo völlig andere Regeln galten, wo die Zivilisation selbst außer Kraft gesetzt war. Ich musste ihn also unter möglichst starken Druck setzen, damit er sich überhaupt mit seinen eigenen Handlungen auseinandersetzt, und ich musste quasi in seinen Kopf hineinkriechen, weil er das natürlich niemals im Gespräch mit anderen äußern würde. Dadurch wird es zum anderen – jedenfalls war das meine Absicht – auch schwerer, Lehmann distanziert zu betrachten. Nach außen hin ist er ja eigentlich ein cooler Typ: Er mag Jazz, Humphrey Bogart, die lässige Art der amerikanischen Kollegen – aber dann schießen ihm immer wieder Gedanken durch den Kopf, die einen nach Luft schnappen lassen. Zu guter Letzt ist der Stil eine Antwort auf die seinerzeitige deutschsprachige Literatur, man denke an die »Gruppe 47«, die ja nach all dem Pomp und Pathos der Nazizeit betont nüchtern und realistisch erzählte. Ich wollte genau das nicht, sondern an die damals abgerissenen Traditionen der Weimarer Zeit anknüpfen und gleichzeitig die Strömungen mit einbeziehen, die sich in der Nachkriegszeit in den USA abspielten und anbahnten, die Filme der Schwarzen Serie, die Beat Generation. Nicht ganz zufällig deckt sich das natürlich auch mit meinen literarischen und filmischen Vorlieben ...
War Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin dabei eine Art Vorbild für Sie?
Definitiv ja. Lehmann ist, wenn Sie so wollen, Franz Biberkopf mit mehr Grips im Kopf und einer Ausbildung im Polizeidienst. Ich fand den Gedanken sehr spannend, dass der Erzähler einer Geschichte nicht deren Protagonist oder ein allwissender Autor ist, sondern sozusagen eine Filmkamera mit Mikro im Kopf des Protagonisten, die gleichzeitig dessen Gedanken lesen kann. Bei Döblin wechselt diese Kamera immer wieder die Perspektive und kann auch mal in die Totale gehen, oder er schneidet ganz andere Inhalte zwischen die Szenen, um ein großes Porträt der Stadt Berlin zu zeichnen. Ein entsprechendes Porträt Münchens hatte ich nicht im Sinn, deshalb verlasse ich niemals Lehmanns Blickwinkel, aber die Erzähltechnik von Berlin Alexanderplatz war schon ein Vorbild. Und nicht nur Döblin, auch Jack Kerouac spielte eine wichtige Rolle, schließlich ist 1948 das Jahr, in dem Sal Paradise und Dean Moriarty beschließen, zum ersten Mal ernsthaft On the Road zu gehen. Auf den ersten Blick hat diese ekstatische Utopie der weiten, offenen Landschaft nichts mit München zur gleichen Zeit zu tun, aber auf den zweiten dann doch wieder: Für einen Moment ist alles offen, das Alte ist zerstört, das Neue noch nicht da; das frühere Leben ist einem durch den Krieg abhandengekommen, aber man 2 kann plötzlich Wege gehen, die einem vorher nicht offen standen. Und ich wollte Kerouacs mäandernde, dem Jazz abgelauschte Satzkaskaden mit hineinholen. Im Grunde war ja die unmittelbare Nachkriegszeit – anders als dann später die restaurativen Adenauer-‐ und Ulbricht-‐Jahre – durch ein heute kaum glaubliches Maß an Unsicherheit, Verbrechen und Amoralität geprägt, und mir erschien es angemessener, diese Epoche mit den Stilmitteln Döblins und Kerouacs abzubilden als mit psychologischem Realismus.
Sie lassen einen fiktiven Ermittler auf ein wahres Verbrechen treffen – denn der Mord, den es im Buch aufzuklären gilt, hat wirklich stattgefunden: Im Frühjahr 1948 tauchte in einem Baggersee bei München eine stark verstümmelte Frauenleiche auf. Was hat Sie an dem Fall so fasziniert?
Ich bin ganz zufällig bei der Recherche für ein Drehbuch darüber gestolpert, aber mir war sofort klar, was ich damit machen musste. Ich hatte mich schon seit längerem mit der Frage beschäftigt, was gewöhnliche Deutsche, Polizisten zumal, im 2. Weltkrieg dazu gebracht hatte, zu Massenmördern zu werden. Die üblichen Antworten – traditionelle deutsche Autoritätshörigkeit, fanatischer Antisemitismus, Angst vor der eigenen Bestrafung usw. – schienen mir irgendwie unbefriedigend, aber ich wusste noch nicht genau, wie ich das in eine Geschichte umsetzen sollte. Die Laufbahn eines typischen Ordnungspolizisten im Kriegseinsatz? Irgendwann wohl ein wenig ermüdend, und dann fehlt der Anreiz, dass er sich selbst analysieren muss. Aber dann dieser Mordfall! Ich musste nur noch einen Polizisten mit einer entsprechenden Hintergrundgeschichte hinzuerfinden, und schon war er genau dazu gezwungen.
Wie haben Sie recherchiert?
Ich bin ausgebildeter Historiker, also habe ich natürlich zunächst einmal alles gelesen, was ich damals zur Münchner Nachkriegszeit, den Ghettos und den Erschießungen durch Polizeibataillone in die Hände bekommen konnte. In den 1990ern gab es ja die Goldhagen-‐Debatte, und seitdem haben auch einige deutsche Historiker entsprechende Arbeiten vorgelegt, eine umfassende Studie zu den Tötungseinsätzen der Ordnungspolizei in der Ukraine fehlt allerdings noch. Ich habe mich darüber hinaus aber auch gewissermaßen selbst als Detektiv betätigt, die alten Fallakten durchwühlt und dann versucht herauszubekommen, was später mit den Personen passiert ist, die die Polizei verhört hatte. Dabei habe ich tatsächlich einen älteren Herrn gefunden, der damals noch lebte und viele von ihnen gekannt hatte. Von dem Mord wusste er allerdings nichts. Er hat mir dann seine eigene Geschichte erzählt: wie er ins Kownoer Ghetto gekommen ist, das Leben dort, die Sklavenarbeit für Moll, den Todesmarsch in Richtung Alpen – das ist natürlich etwas ganz anderes als nur ein Buch darüber zu lesen.
Wo, würden Sie sagen, verläuft in Ihrem Text die Grenze zwischen Fakt und Fiktion?
Ich bin da ein bisschen in den Fußstapfen James Ellroys gewandelt und habe mir die Aufgabe gestellt, wie bei Die schwarze Dahlie einen Polizisten und einen Täter so in einen ungelösten Fall hineinzumontieren, dass ich einerseits nicht in Widerspruch zu den Fakten gerate, andererseits aber trotzdem eine spannende Geschichte erzähle. Lehmann und die Auflösung am Ende sind also erfunden, ebenso die meisten Nebenfiguren, 3 andererseits habe ich möglichst penibel darauf geachtet, die jeweiligen Zeitumstände zu berücksichtigen, etwa beim Fall Wilfried Helms, der sich genau an den beschriebenen Tagen abgespielt hat, oder bei den Demonstrationszügen durch die Münchner Innenstadt. Was den realen Kriminalfall angeht, folge ich weitestgehend den tatsächlichen Ermittlungen, Namen und einige Details sind aber geändert, es handelt sich ja nicht um Personen der Zeitgeschichte. Ich mache auch keine Aussagen über die Figuren, die ich nicht irgendwie belegen kann. Dass beispielsweise der Tabak-‐ und Briefmarkenhändler während des Krieges einen Industriebetrieb in Krakau geführt hatte und Parteigenosse gewesen war, weiß ich vom Berlin Document Center, die Polizei hat das damals nicht ermittelt. Den Zustand der Leiche habe ich allerdings nicht irgendwie geändert. Sie sah genauso aus, wie ich sie beschreibe! Was die Hintergrundgeschichte Lehmanns im Krieg angeht, bin ich ähnlich verfahren. Er ist eine fiktive Figur, die an tatsächlichen Handlungen teilnimmt. Auch hier ist das eine oder andere Detail literarisch verdichtet, aber im Großen und Ganzen hat sich das ja alles auf diese Weise zugetragen. Ganz fiktiv sind allerdings die Ermittlungen der War Crimes Group, in Wirklichkeit hat sich bis in die 1960er Jahre hinein niemand um die ehemaligen Ordnungspolizisten und ihre Verbrechen gekümmert.
Quelle: Pressematerial des ars vivendi Verlags
Lesung: »Wolfsstadt« (2015)
Lesung mit Bernd Ohm zu seinem Debütroman.
Zeit: 06. November 2015
Ort: Stadtbibliothek Paderborn, Am Rothoborn 1, 33098 Paderborn
Veranstalter: Alles Kunst e.V., Paderborn
Buch-Cover »Wolfsstadt«

Bernd Ohm (© 2015, Jeanette Atherton)